|
 Dem
Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich
eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten
Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums
in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der
nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart
für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis
österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols
abenteuerlichstes Wildwasser". Dem
Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich
eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten
Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums
in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der
nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart
für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis
österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols
abenteuerlichstes Wildwasser".
Es handelt sich um das
Gebiet der Roten und Weißen Valepp, die sich etwa an der Landesgrenze
zwischen Bayern und Tirol zur Brandenberger Ache vereinigen
und dann durch eine wilde Schluchtenlandschaft über Kaiserklamm,
Tiefenbachklamm nach Kramsach ihre Wassermassen in den Inn führen.
Beidseits dieser Wildwässer erstreckt sich eines der größten
Waldgebiete Südbayerns und Nordtirols.
73 km2
umfasst das Einzugsgebiet, aus dem das Holz zu Tal gebracht
wurde. Das Holz wurde schon im Mittelalter in kleinerem Umfange
auf diesen Gewässern getriftet, aber erst im 15. Jahrhundert
beginnt die Geschichte der größten Trift auf europäischem Boden.
1409 erteilte der damalige Herzog Stefan III. von Oberbayern-Tirol
den Grafschaften Brandenberg, Rattenberg und Kramsach die Erlaubnis,
einen Rechen zum Auffangen des Holzes zu erbauen. Dieser entstand
am Ende der Brandenberger Ache vor der Einmündung in den Inn
in der Nähe von Kramsach.
1480 begann unter der Herrschaft
des bayerischen Herzogs Albrecht IV., der mit Elisabeth von
Österreich verheiratet war, die ausgiebige Nutzung und der umfangreiche
Waldeinschlag in diesem riesigen Gebiet. Grund war die Entstehung
der Bergbau- und Hüttenbetriebe um Rattenberg, Schwaz und Kramsach.
Dort wurde damals Eisenerz, Kupfer, ja sogar Silber und Gold
im Bergbau gewonnen und verhüttet. Die dafür notwendigen enormen
Holzmengen erforderten daher eine besondere Art der Talbringung.
So entstand die Trift der Brandenberger Ache.
 Die Voraussetzungen
für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,
bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt
auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in
dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.
Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man
auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert
zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen
Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln
gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein
Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die
Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa
von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz
nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.
Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr. Die Voraussetzungen
für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,
bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt
auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in
dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.
Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man
auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert
zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen
Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln
gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein
Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die
Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa
von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz
nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.
Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.
 Damals gehörte
der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,
die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.
Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12
Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach
dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte
Klause gebaut. Damals gehörte
der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,
die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.
Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12
Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach
dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte
Klause gebaut.
Ganze 7 mal musste dieses Stauwerk bei der
Erstellung des Triftbetriebs erneuert werden, weil die ersten
Holzkastenklausen dem enormen Druck und der Belastung durch
Wasser und Stämme nur etwa 15 Jahre Stand hielten.
1934 wurde
die Klause dann einige Meter weiter talwärts verlegt und erstmals
mit Betonpfeilern ausgerüstet. So ergab sich eine Stauhöhe von
damals 14 Metern.
Es folgt eine kurze Beschreibung
einer Trift. Wie ging eine solche Trift vor sich?
Forstamtmann Max Fackler soll
jetzt zu Wort kommen, da er schon sehr viel Verkehrtes über
diese komplizierte Angelegenheit geschrieben und berichtet bekommen
hat.
 Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist
unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und
Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist
in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große
Stücke geschnitten. Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist
unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und
Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist
in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große
Stücke geschnitten.
Man hat sie zum Teil zur Winterzeit
bei geeigneten Schneeverhältnissen talwärts getrieben und auch
am Schlitten befördert. In anderen Jahreszeiten wurden sie von
den Holzknechten in mühevoller und gefährlicher Handarbeit über
die mit minderwertigem Rundholz ausgelegten Fels- und Geröllgräben,
die sog. "Loitn" bergab geholzt. Eine verbesserte
Form dieser "Loitn" waren später die "Riese".
Das waren regelrecht ausgebaute Rutschbahnen. Weil es natürlich
nicht immer pfeilgrad bergab ging, bedienten sich die Holzknechte
vor der großen Trift auch häufig noch kleinerer Trifte, für
die man Nebenbäche durch eine "Schütz" oder Wehr "g'schwöllt",
also aufgestaut hat.
 Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten
gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der
Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,
so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile
lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in
Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung
nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst
in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.
Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor
der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"
in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann
das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,
die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem
tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme
auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend. Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten
gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der
Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,
so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile
lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in
Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung
nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst
in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.
Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor
der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"
in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann
das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,
die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem
tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme
auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.
|

|
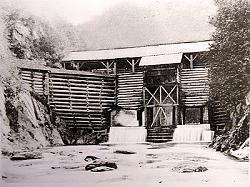
|
Man
kann sich vorstellen, welch ungeheuer anstrengende und gefährliche
Arbeit es für die sog. Triftmeister war, mit langen Grießhaken
und Sapins, zum Teil halsbrecherisch im reißenden Wasser auf
Stämmen balancierend, möglichst viele Baumstämme mit der großen
Schwöllung in Gang zu bringen. Denn alles, was nach der etwa
2 Stunden anhaltenden Flut noch zwischen Felsen und Wurzeln
verkeilt oder ineinander in "Füchs`n" verzwickt dalag,
musste in wahrer Sauarbeit der Trift beim Nachräumen der großen
Sendung hinterhergeschickt werden.
 Ganz genau ist es nie
gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den
ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km
betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden
Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis
zu 20 % einkalkulierte. Ganz genau ist es nie
gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den
ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km
betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden
Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis
zu 20 % einkalkulierte.
Einiges verklemmte sich unterwegs
hoffnungslos. Andere Stämme, die ankamen, waren böse mitgenommen
und entsprechend in der Qualität gemindert.
Die Lände in
Kramsach bestand aus einem raffiniert ausgeklügeltem System
verschiedener Rechen, Schleusen, Kanäle und Sandgitter. Trotz
dieser Einrichtungen, mit denen das bis zu 4 m lange Holz in
den verschiedenen Ausländeplätzen sortiert und gestapelt wurde,
hatten die Arbeiter auch dort schwerste Knochenarbeit zu leisten.
Nicht selten standen sie dabei wieder bis zu den Hüften im eiskalten
Wasser.
Die Abnehmer des Holzes waren, wie oben geschildert,
Silber-, Kupfer- und Bergbauminen des Inntals. Später kamen
auch in Kramsach selbst eine Schmelzhütte und ein Messingwerk
in Achenrain dazu.
|

|

|
Im 17. Jahrhundert wurde noch eine Glashütte
zum Nutznießer des Holzreichtums. Auch eine Kupferhütte bei
Brixlegg kam dazu. Eine Zeit lang wurde das Triftholz auch weiter
den Inn hinunter zu den Sudkesseln der Rosenheimer Salinen geflößt.
 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes
dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für
das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des
Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren
Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der
Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war
es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung
auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik
(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig
machte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes
dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für
das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des
Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren
Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der
Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war
es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung
auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik
(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig
machte.
Die letzte Trift erfolgte 1966. Die Bevölkerung des
Tals der Brandenberger Ache musste noch einige Jahre einen harten
Kampf ausfechten, da die staatliche österreichische Kraftwerksgesellschaft
im Verlauf der Brandenberger Ache den Bau mehrerer Staustufen
mit Kraftwerken beabsichtigte, um die Stadt Kufstein mit Strom
zu versorgen.
|

|

|
Am 5. Jan. 1988 wurde das ganze wilde Tal dann
endlich zum Naturdenkmal erklärt. Störend sind jetzt nur noch
die wilden Zeltler und Griller im ansonsten unversehrten Revier.
Man
sollte sich allerdings vor Augen führen, wie sehr die Trift
die Bergnatur schon vor einigen hundert Jahren nicht nur verändert,
sondern auch ausgeraubt hat. Es war ja vor allem Laubholz für
die Verkohlung besonders geeignet. Und junges Laubholz hatte
bei den hohen Wildbeständen zur Zeiten fürstlichen Weidwerks
aber auch durch die Erosionen als Folge des radikalen Holzeinschlags
kaum noch Aussicht, den ursprünglichen Bergmischwald neu zu
beleben. Erst heute können wir an den Folgen des eigenen Raubbaus
an der Natur auch diese frühen Sünden und den Beginn allen Übels
erkennen.
|
 Dem
Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich
eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten
Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums
in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der
nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart
für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis
österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols
abenteuerlichstes Wildwasser".
Dem
Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich
eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten
Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums
in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der
nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart
für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis
österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols
abenteuerlichstes Wildwasser". Die Voraussetzungen
für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,
bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt
auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in
dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.
Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man
auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert
zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen
Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln
gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein
Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die
Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa
von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz
nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.
Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.
Die Voraussetzungen
für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,
bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt
auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in
dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.
Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man
auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert
zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen
Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln
gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein
Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die
Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa
von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz
nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.
Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.  Damals gehörte
der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,
die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.
Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12
Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach
dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte
Klause gebaut.
Damals gehörte
der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,
die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.
Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12
Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach
dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte
Klause gebaut.  Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist
unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und
Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist
in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große
Stücke geschnitten.
Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist
unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und
Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist
in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große
Stücke geschnitten.  Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten
gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der
Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,
so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile
lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in
Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung
nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst
in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.
Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor
der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"
in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann
das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,
die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem
tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme
auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.
Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten
gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der
Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,
so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile
lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in
Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung
nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst
in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.
Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor
der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"
in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann
das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,
die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem
tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme
auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.
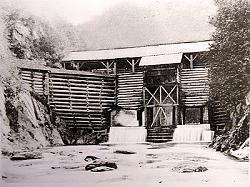
 Ganz genau ist es nie
gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den
ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km
betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden
Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis
zu 20 % einkalkulierte.
Ganz genau ist es nie
gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den
ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km
betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden
Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis
zu 20 % einkalkulierte. 

 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes
dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für
das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des
Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren
Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der
Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war
es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung
auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik
(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig
machte.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes
dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für
das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des
Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren
Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der
Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war
es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung
auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik
(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig
machte.

